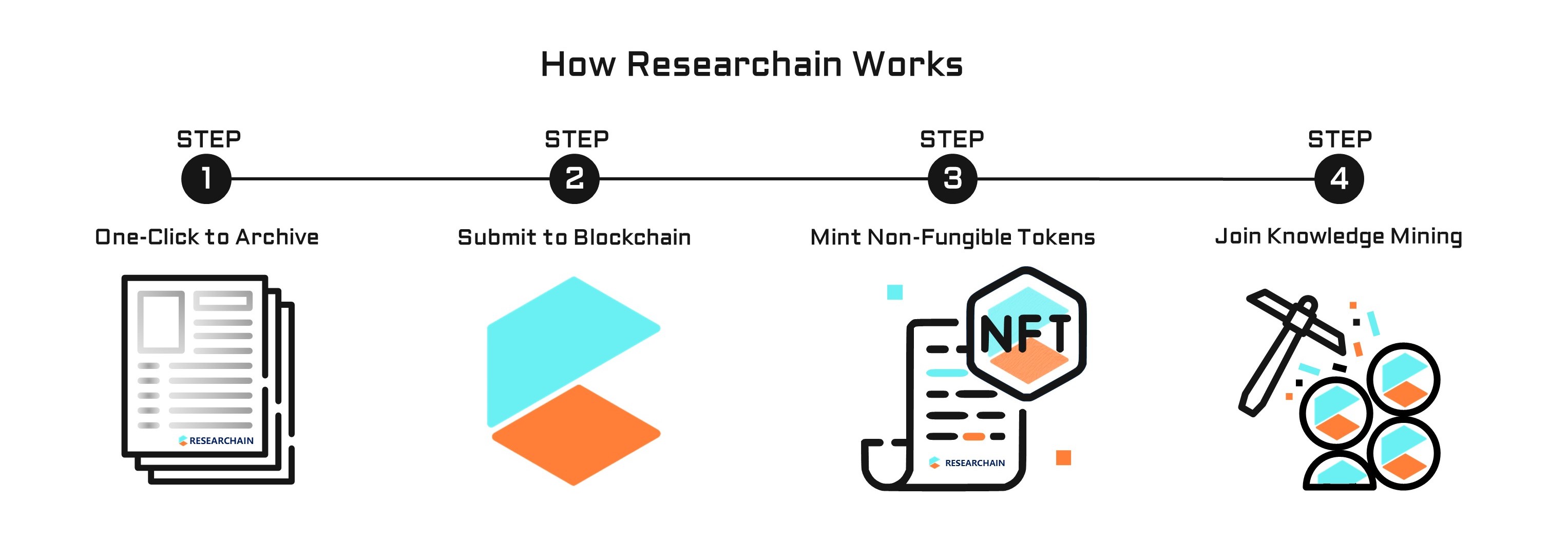Network
Latest external collaboration on country level. Dive into details by clicking on the dots.
Publication
Featured researches published by Daniel Jacob.
Archive | 2009
Daniel Jacob; Andreas Kablitz; Bernhard König; Margot Kruse; Joachim Küpper; Christian Schmitt; Wolf-Dieter Stempel
1.1. El español, como, presumiblemente, todas las lenguas naturales, dispone de diversos mecanismos de intensificación o énfasis de naturaleza diversa (Cisneros 1957, 1966; González Calvo 1984–1988; Meyer-Hermann 1988; García-Page 1990, 1997, 2001, 2008: 316–329; Herrero Moreno 1991; Penas Ibáñez 1993–1994; Briz Gómez 1996; Arce Castillo 1999; Albelda Marco 2004, etc.): fónica (entonación, reduplicación de sonidos o sílabas, etc.), morfológica (afijos intensificadores: re-, super-, -ísimo...), léxica (cuantificadores: mucho, extraordinariamente, etc.; sustantivos, adjetivos y adverbios que denotan ‚intensificación‘, algunos de ellos de naturaleza colocacional: óptimo, fenómeno, [obra] faraónica, [fuerza] colosal/descomunal, [memoria] prodigiosa/portentosa, [error] garrafal/craso, [esfuerzo] ímprobo/titánico, [fracaso] estrepitoso/rotundo, [prohibir] terminantemente, [llover] torrencialmente...), sintagmática (repetición léxica, superlativo relativo...). Entre las estructuras sintácticas de énfasis, destacan las frases elativas con la forma de sintagma prepositivo (Zuluaga Ospina 1980: 146–149; García-Page 1990; Ruiz Gurillo 1995 y 1997) – muchas de ellas, locuciones adjetivas (de perros, de padre y muy señor mío, de aquí te espero, como puños, sin par...), adverbiales (a raudales, a cántaros, a punta de pala, a todo gas, en un periquete...) o adjetivas y adverbiales (con ganas, de narices, a base de bien, de cine, por un tubo...) –, los cuantificadores nominales del tipo un montón, un porrón, una barbaridad, etc. [esquema «un + N»] o la tira de, la mar de, etc. [esquema «la + N + de»], y el intensivo la de + N[+pl., +colect. o +continuo] + Oque (la de veces que te lo he dicho, la de gente que hay, la de agua que ha caído), la consecutiva enfática (que no se lo salta un gitano, que para qué, que pela, que trina/bufa/se sube por las paredes, que se las pela, que es una bendición, que da gusto, que alimenta...) y la comparativa (como un piano, como la copa de un pino, como una catedral, como un templo...).
Archive | 2009
Daniel Jacob; Andreas Kablitz; Bernhard König; Margot Kruse; Joachim Küpper; Christian Schmitt; Wolf-Dieter Stempel
„Recuerdo un olor ...“ – so lauten die ersten Worte der gleichnamigen autobiographischen Kurzerzählung von Rosa Chacel, in der es um eine künstlerische Initiationsoder Epiphanieerfahrung im Madrider Parque del Retiro der Vorkriegszeit geht und die 1992 in der Revista de Occidente erschienen ist.1 „Recuerdo [...] un olor“ ist aber auch diejenige Formel, die im ersten Satz von Juan García Hortelanos Kurzgeschichte La capital del mundo aus dem Jahre 1983 zur Analepse einer nostalgisierenden Narration überleitet, bei der zunächst einmal eine Kinderperspektive eingenommen wird, zur Zeit der Belagerung Madrids während des Bürgerkriegs, und zwar aufgrund des erinnerten Dufts von nach Schießpulver riechendem Kommißbrot, das in eine Tasse Milch mit Malz getunkt wird.2 Als Paraphrase charakterisiert der Ausdruck Recuerdo un olor schließlich auch treffend mehrere Passagen aus dem Werk Francisco Umbrals, insbesondere in Trilogía de Madrid (1984), in der nunmehr eindeutig das Madrid der Nachkriegszeit, seit den 1960er Jahren, im Zentrum steht.3 Allen drei Texten gemeinsam ist die Kombination und Korrelation des Modus der autobiographischen bzw. autobiographisch gefärbten Erinnerung mit olfaktorischer Wahrnehmung; insofern greifen sie – zumindest auf den ersten Blick – das moderne Proustsche Modell der mémoire involontaire auf, versinnbildlicht anhand jener berühmten Szene aus der Recherche, in der der Geruch und der Geschmack einer madeleine in Verbindung mit Lindenblütentee Marcels Erinnerung stimuliert. Angesichts der Erscheinungs-
Archive | 2009
Daniel Jacob; Andreas Kablitz; Bernhard König; Margot Kruse; Joachim Küpper; Christian Schmitt; Wolf-Dieter Stempel
„Et nostre boucquet sera plus beau, tant plus il sera remply de differentes choses.“2 Das Bild des bunt zusammengesetzten Blumenstraußes, das Ennasuite in einer poetologischen Passage zur Bezeichnung von Marguerite de Navarres L’Heptaméron (1559) verwendet, birgt den Charme, aber auch die Problematik der Novellensammlung im allgemeinen und des Heptaméron im besonderen. Ist das Bouquet vor allem ein Strauß, eine gebundene und bindende Einheit, wie dies an ganz anderer Stelle Fontanes Lene Nimptsch ihrem Baron Botho von Rienäcker erklärt?3 Oder besteht, wie das Zitat mit dem Verweis auf „differentes choses“ ja nahelegt, der Strauß aus einer mehr oder weniger heterokliten, eher zufällig versammelten Vielheit einzelner Blumen? Diese Frage soll Gegenstand der folgenden Überlegungen sein. In der Literaturwissenschaft setzt man die Novelle auf Grund von Semantik und Wortgeschichte des Genrenamens seit langem mit dem Individuellen, ja Singulären und Einzigartigen in Verbindung. Geschichtlich scheint sich der Befund gleichfalls zu erhärten: Spätestens seit Hans-Jörg Neuschäfers Studie Boccaccio und der Beginn der Novelle 4 gilt in weiten Teilen der Forschung die Behauptung als belegt, die Novelle (über Boccaccio hinaus) präsentiere seit Beginn der Renaissance die Vereinzelung, sowohl der Erfahrung als auch des Erzählgegenstan-
Archive | 2009
Daniel Jacob; Andreas Kablitz; Bernhard König; Margot Kruse; Joachim Küpper; Christian Schmitt; Wolf-Dieter Stempel
Wie lang oder kurz man sich die Vorgeschichte des erhaltenen Rolandsliedes1 auch vorstellen mag – heute gibt es wohl keinen Forscher, der dem Lied jede Vorgeschichte abspricht, es sich gleichsam dem Haupt des Dichters entsprungen denkt wie Athene dem Haupt des Zeus. Und da die Entwicklung des Stoffes doch von dem historischen Kern des Liedes, dem Untergang der fränkischen Nachhut, ihren Ausgang genommen haben dürfte, drängt sich der Schluß auf, daß es einmal ein Lied noch ohne Blancandrin-Szene, ohne Baligant-Teil, mit einem nur rudimentären Prozeß gegen Ganelon2 und ohne die Schlußverse um Vivien, Bire und Imphe gab. Andererseits sollte nach den Forschungen der letzten etwa siebzig Jahre unbestritten sein, daß jener Literat – nenne man ihn Dichter, Bearbeiter oder wie immer –, der das erhaltene Lied ‚verantwortet‘, das heißt, in essentiell der auf uns gekommenen Form aus der Hand gab, ein hochgebildeter Kleriker war und ohne diese Bildung seinem Werk nicht jene Dichte und Tiefe hätte geben können, die es hinaushebt nicht nur über die anderen chansons de geste, sondern zugleich über die ganze Epoche früher romanischsprachiger Dichtung.3 Ohne daß wir völlig sicher
Archive | 2009
Daniel Jacob; Andreas Kablitz; Bernhard König; Margot Kruse; Joachim Küpper; Christian Schmitt; Wolf-Dieter Stempel
Las obras gramaticales destinadas a la enseñanza del español como lengua extranjera en el siglo XVII presentan, salvo alguna particular excepción, escasa originalidad y exiguo contenido teórico. Como muchas de las que se redactaron con la finalidad de ayudar a aquellos que deseaban aprender una segunda lengua, se inscriben en una cadena de obras breves escritas para tal fin práctico, que son producto de la adaptación, glosa, resumen o simplemente copia de otras obras anteriores. Pero, como dice Gómez Asencio (2001: „Introducción“) respecto de su selección de Antiguas gramáticas del castellano, „cada texto gramatical, aun compartiendo rasgos, concepciones, modos de organización, contenidos con el resto de los de su entorno – forma parte de una tradición –, es un pequeño universo de doctrinas, sugerencias, propuestas o teorías hasta cierto punto único: el combinado final, el producto es personal de cada autor y merecedor de respeto intelectual por un lado y de un estudio detallado que muestre su grado de originalidad y de aceptación de postulados de época o de escuela“. Y, como veremos, éste es el caso del guipuzcoano Juan Ángel de Zumarán2 (escrito Sumaran y Summaran en algunos
Archive | 2009
Daniel Jacob; Andreas Kablitz; Bernhard König; Margot Kruse; Joachim Küpper; Christian Schmitt; Wolf-Dieter Stempel
Habent sua fata libelli. Fast scheint es, als sei das wechselvolle Schicksal von Petrarcas De remediis selbst ein Beispiel jener Fortuna in beiderlei Gestalt, die der Gegenstand von Petrarcas dialogischen Betrachtungen ist. Petrarcas De remediis utriusque fortunae war das einzige unter Petrarcas zahlreichen Werken, das schon zu seinen Lebzeiten überall in Europa Aufnahme fand. In den ersten Jahrzehnten des Buchdrucks erfuhr es in ganz Europa zahllose Auflagen und wurde schnell in fast alle europäischen Sprachen übersetzt.1 Ihm vor allem verdankte Petrarca seinen europäischen Ruhm, noch ehe er mit seinen Rerum vulgarium fragmenta in ganz Europa einen Paradigmenwechsel der Lyrik einleitete. So sehr Petrarca mit seinen Heilmitteln gegen Fortuna in beiderlei Gestalt den Nerv seiner Zeit und seiner unmittelbaren Nachwelt traf, so vollkommen erlosch der Glanz seines Buchs nach der Wende zum 17. Jahrhundert, so daß seither über Jahrhunderte keine vollständige Ausgabe mehr in Umlauf kam. In Deutschland erschien erst 1975 eine schmale Auswahl2, und erst seit der 2002 erschienenen Ausgabe mit Kommentar und französischer Übersetzung von Christophe Carraud3 ist der Text wieder verfügbar, der so lange seine Lesbarkeit verloren zu haben schien. De remediis utriusque fortunae steht in einer langen Tradition des römischen Stoizismus, die von Ciceros Tusculanes ihren Ausgang nimmt, mit denen er in Auseinandersetzung mit den griechischen Philosophenschulen einen eigenständigen römischen Diskurs der Moralphilosophie begründen wollte. Von Cicero an gibt es
Archive | 2009
Daniel Jacob; Andreas Kablitz; Bernhard König; Margot Kruse; Joachim Küpper; Christian Schmitt; Wolf-Dieter Stempel
Dominique Wolton (Demain la francophonie, 2006) hält die Zeit für gekommen, die Diversität, genauer: die kulturelle Diversität der frankophonen Länder (zu denen er Frankreich zählt) als Aufgabe mit hoher Priorität zu behandeln. Der Auftrag der Politik, so Wolton, müsse darin bestehen, die französische Identität insofern zu erweitern, als sie sich nicht auf die Einbindung Frankreichs in ein zusammenwachsendes Europa beschränken dürfe, sondern vielmehr eine frankophone, weltweite Perspektive neu eröffnen müsse1. Diese Eröffnung beginne mit der Anerkennung von drei französischen Sprachen:
Archive | 2009
Daniel Jacob; Andreas Kablitz; Bernhard König; Margot Kruse; Joachim Küpper; Christian Schmitt; Wolf-Dieter Stempel
Der vorliegende Artikel nimmt eine innovative Fragestellung (von Stowell 2004 und Zagona 2007 neben anderen) auf und entwickelt sie mit Ergebnissen aus eigener Forschung am Deutschen und daran anknüpfenden Überlegungen weiter. Es geht darum, inwieweit Tempus und Aspekt die Setzung von Modalität bzw. Modus beeinflussen. Der Vergleich von M(odus)T(empus)A(spekt)-Markierung und MTA-Referenz im Deutschen, Englischen und den romanischen Sprachen ist ein großes Desiderat angesichts der für Deutschund Englischsprecher auffallenden Verhältnisse in den romanischen Sprachen, wo das epistemische Modalverb unter einer Art attractio dazu tendiert, die MTA-Spezifizierung zu übernehmen, die logisch eigentlich dem Vollverb (nämlich der Ereignisreferenz) zukommt: (1) Pedro tuvo/tenía que estar presente, zu übersetzen mit dt. (2) Peter muss anwesend gewesen sein, d. h.: modale Auswertung in der Gegenwart, Ereignis in der Vergangenheit. Dadurch entsteht in den romanischen Sprachen generelle Ambiguität zwischen solchen Modalausdrücken, deren modale Auswertung zum Sprechzeitpunkt oder in der Vergangenheit (zum Ereigniszeitpunkt) liegt: (1) z. B. ist auch übersetzbar als dt. (3) Peter musste anwesend sein. Dieser bekannte Ausgangsbefund wird im vorliegenden Aufsatz in eine weitere, thematisch und sprachlich übergreifende, kontrastive Perspektive (mit Daten vor allem aus dem Deutschen, aber auch dem Niederländischen und Englischen) überführt: Es werden zunächst die Zusammenhänge zwischen verschiedenen modalen Lesarten (deontische bzw. Grund-Modalität vs. epistemische Modalität) systematisch untersucht, zwischen Tempus bzw. Zeitreferenz einerseits und Aspektualität andererseits. Dabei gibt es insbesondere Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Aspekten für dem Modal untergeordnete Proposition und der epistemischen/deontischen Lesart des Modalausdrucks sowie den zeitlichen Projektionen des referierten Ereignisses und der zeitlichen Verankerung der modalen Auswertung („Beurteilungszeitpunkt“). In einem weiteren Schritt wird die Frage der (Kontra-)Faktizität des referierten Ereignisses behandelt: Die verschiedenen Kombinationen (Modalverb im Präsens, Präteritum, Perfekt, Imperfekt) ergeben auch hier kontrastive Vielfalt und Anlass zur Frage nach den Faktoren, die die faktische oder kontrafaktische Auslegung für die eingebettete Proposition bedingen. Mit der Frage der Faktizität ist auch die Frage des Modus ins Spiel gebracht, der ähnlich wie Tempus zwar am Modalverb kodiert wird, aber ebenso Aussagen über die Faktizität der eingebetteten Proposition macht. Mit Modus ist darüber hinaus die Kategorie der Assertion bzw. genereller der Illokution und des Illokutionstyps aufgeworfen. Abschließend wird eine Operatorenhierarchie vorgeschlagen, ausgedrückt in Form einer generativ gefassten syntaktischen Hierarchie, in der jeder der genannten Operatoren (Assertionstyp/Illokutionskraft, Tempus, Modalität (wobei epistemische und Grund-Modalität auf verschiedene Knoten verteilt sind)) einen eigenen Phrasenknoten bildet – einer Hierar-
Archive | 2009
Daniel Jacob; Andreas Kablitz; Bernhard König; Margot Kruse; Joachim Küpper; Christian Schmitt; Wolf-Dieter Stempel
Der Roman des 19. Jahrhunderts ist dominant realistisch. Macht man eine solche Aussage heute, dann läßt der Vorwurf retrograder Naivität sicher nicht auf sich warten. Denn im Fokus der aktuellen Diskussion über jene Literatur, die man einmal die realistische genannt hat, stehen derzeit andere Dinge: die Phantasie, das Imaginäre, die Transgression.2 Gleichwohl scheint es mir, daß die Frage nach dem ‚Realismus‘ – jenseits kurzschlüssiger Widerspiegelungskonzepte – nach wie vor den poetologischen Kern der weitesten Bereiche der Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts in den Blick zu nehmen imstande ist. Mit dieser Annahme bewegt man sich durchaus in guter Gesellschaft, ist es doch eine der bedeutenden Leistungen von Erich Auerbachs Mimesis, unbeschadet aller möglichen Einwände3 einsichtig gemacht zu haben, daß und wie sich im Zug der Verabschiedung der „klassizistischen Lehre von den Höhenlagen“ im 19. Jahrhundert ein „moderner Realismus“ herausbildet, mit dem der Roman zu eben jenem literarischen Bereich avanciert, in dem auf ernsthafte, mithin problematische oder tragische Weise „Anschauungen von Wirklichkeit“ relational zu historischen Bewußtseinsformen verhandelt wer-
Archive | 2009
Daniel Jacob; Andreas Kablitz; Bernhard König; Margot Kruse; Joachim Küpper; Christian Schmitt; Wolf-Dieter Stempel
Der Buchstabe K zur Wiedergabe des stimmlosen okklusiven Velarlautes /k/ wird traditionell in den romanischen Sprachen wenig verwendet. In der lateinischen Schreibung wurde das Phonem /k/ durch wiedergegeben1. Lausberg sieht den Grund für die drei Repräsentationsmöglichkeiten in der semitischen Herkunft des Alphabets, wo den einzelnen Zeichen jeweils ein wirkliches Phonem entspricht, während es sich im Lateinischen nur um phonetische Varianten eines Phonems [k] handelt. Diese Redundanz wurde dadurch vermieden, dass sich die Korrespondenz /k/ – durchsetzte (seltene Ausnahmen in spätlateinischen Inschriften sind kaput neben caput; und für [kw])2. Die Seltenheit des Graphems im klassischen Latein erklärt auch, weshalb es in den romanischen Sprachen relativ selten verwendet wird. Im Folgenden soll die Geschichte dieses Buchstabens in den romanischen Sprachen, insbesondere dem Spanischen, Französischen und Italienischen, nacheinander dargestellt und seine Frequenz und Bedeutung, insbesondere seine Konnotationen und sein Symbolwert, in der Gegenwartssprache aufgezeigt werden.