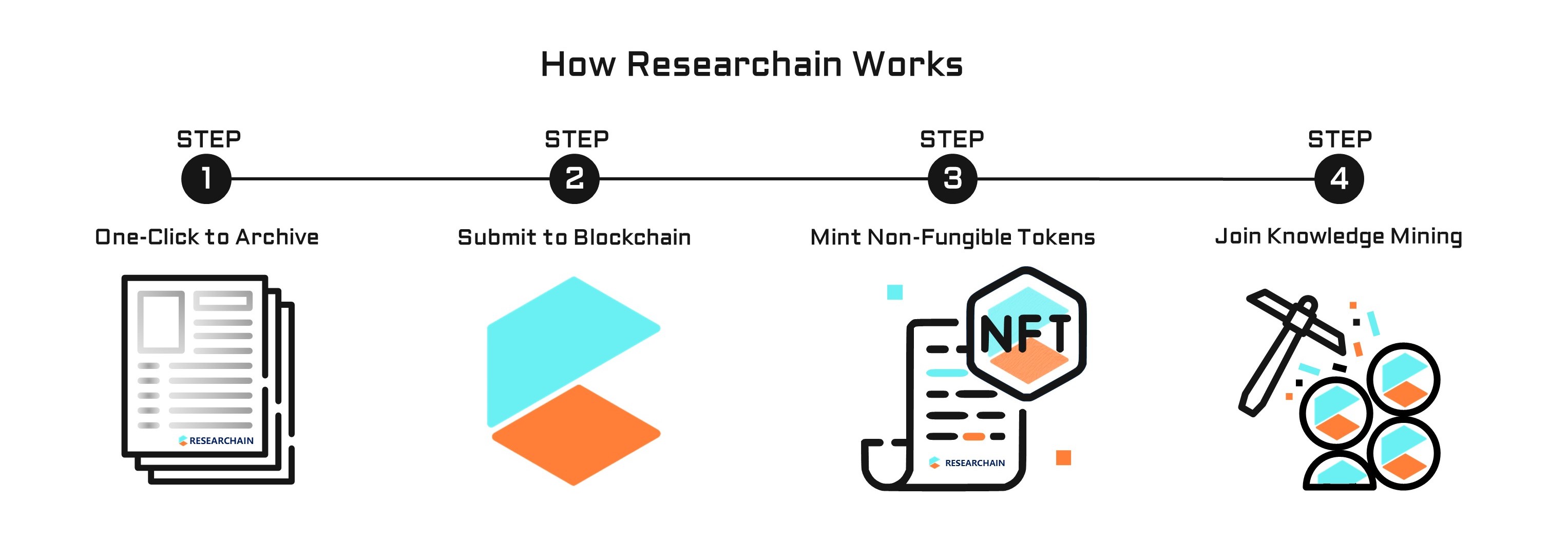Network
Latest external collaboration on country level. Dive into details by clicking on the dots.
Publication
Featured researches published by Norbert Miller.
Archive | 2007
Carl Dahlhaus; Norbert Miller
»Rez. hat eins der wichtigsten Werke des Meisters, dem als Instrumentalkomponisten jetzt wohl keiner den ersten Rang bestreiten wird, vor sich; er ist durchdrungen von dem Gegenstande, woruber er sprechen soll, und niemand mag es ihm verargen, wenn er die Grenzen der gewohnlichen Beurteilungen uberschreitend, alles das in Worte zu fassen strebt, was er bei jener Komposition tief im Gemute empfand.«1 Maskiert als redaktionelle Vorbemerkung, enthalt der Anfang jenes Aufsatzes uber Beethovens Symphonie in c-moll, op. 69, dessen Leitsatze jedem Musiker und jedem Bewunderer der Romantik gelaufi g sind, das eigentliche, das personliche Gestandnis des Verfassers: Beethovens neues Werk mus den Komponisten Hoffmann im Innersten getroffen haben. Er spricht von dieser Begegnung wie von einem Erweckungserlebnis. Ein Unaussprechliches habe er tief im Gemut empfangen, als er sich in die Komposition versenkt habe. Nun gelte es, alle Empfi ndung und alle sprachlose Erkenntnis in Worte zu fassen. Der pietistische Wortschatz stellt sich wie von selbst ein, um die verwandelnde Kraft zu charakterisieren, die vom Studium der Komposition ausging und die dem Musiker die langere Beschaftigung wie einen schopferischen »Durchgangsaugenblick« erscheinen lies. Wenn man sich die Sonderstellung dieser ersten Beethoven-Rezension im Ganzen von E.T.A. Hoffmanns Schriften zur Musik vergegenwartigen will, mus man um diese Erschutterung des Ich, um diese Betroffenheit durch Beethovens Tonsprache wissen.
Archive | 2007
Carl Dahlhaus; Norbert Miller
»La damnation de Faust« von Berlioz trug ursprunglich den Untertitel »opera de concert«, der dann in »legende« und schlieslich in »legende dramatique« umgewandelt wurde. Die fruhere Bezeichnung wurde jedoch durch die spatere keineswegs aufgehoben: Der Wechsel ist nichts als die Hervorhebung einer anderen Seite derselben Sache. Auserdem sollte der Untertitel »legende« offenbar den voraussehbaren — und unvermeidlichen — Vorwurf abwehren, das Goethes Dichtung librettistisch — als Material einer Gattung geringeren Ranges — misbraucht worden sei: Die »legende«, die aus dem 16. Jahrhundert stammt, steht, wie Berlioz glaubte, jedem zur Verfugung, der sich zum »Weiterdichten« an ihr, sei es mit literarischen oder musikalischen Mitteln, berufen fuhlt. Und das die »Damnation« Teile von Goethes »Faust« enthalt, besagt bei einer »legende« nicht, das es sich um den Verschleis eines Schauspieltextes als Opernlibretto handelt, sondern das in dem Prozes des »Weiterdichtens« an einem Mythos — und Faust ist, neben Hamlet und Don Juan, einer der wenigen originaren Mythen in der Literatur der europaischen Neuzeit — Bruchstucke fruherer Auspragungen in den spateren mitgetragen werden.
Archive | 2007
Carl Dahlhaus; Norbert Miller
Wolfgang Robert Griepenkerl, als Dichter Essayist und als Essayist Kritiker im Geiste des Linkshegelianismus, ruhmte 1838 Meyerbeers »Hugenotten« als ein Werk, das »welthistorisch pulsierte. Nicht einseitig sind darin individuelle Zuge geschildert; die Allseitigkeit der Beziehungen, die universelle Bedeutung tritt uberall hervor und hebt uns in der Geschichte innerstes Heiligtum, wo wir die Schauer des Weltgeistes fuhlen«. Es sei darum nicht erstaunlich, »das ein Werk von so hoher historischer Kraft und Wahrheit mitten in einer Zeit, die nach solchem Ausdruck in der Kunst verlangt, enthusiastisch und mit stets gesteigerter Teilnahme aufgenommen wurde«.1
Archive | 2007
Carl Dahlhaus; Norbert Miller
Wagner und Verdi, die musikalischen Antipoden des 19. Jahrhunderts, waren sich einig in einer fundamentalen Pramisse, aufgrund derer sie uber Wesen und Entwicklung der Oper urteilten: in der Voraussetzung, das das Musikdrama im symphonischen Stil wurzele und insofern einen ausschliesenden Gegensatz zur traditionellen Oper bilde. Und das Verdi im uberlieferten Schema die ursprungliche, in der Natur der Sache begrundete Gattungsform, Wagner dagegen ein Entfremdungsphanomen sah, ist im Grunde weniger entscheidend als die Ubereinstimmung im Urteil uber den Sachgehalt des Gegensatzes.
Archive | 2007
Carl Dahlhaus; Norbert Miller
Sechsmal war Carl Maria von Weber zwischen 1812 und 1825 in Berlin. Er hat die preusische Hauptstadt in den Tagen der franzosischen Okkupation kennengelernt, im verwirrten Hochgefuhl nach den Freiheitskriegen, in der beginnenden und ihrer Macht bewusten Restauration. Er hat die Stadt, mit deren Namen ihn der Triumph des »Freischutz« fur immer verbindet, jedoch nur als Besucher gekannt, als reisender Enthusiast in E.T.A. Hoffmanns Sprachgebrauch. Mit Breslau und Schlos Carlsruhe in Schlesien, mit Stuttgart, Prag und vor allem Dresden verbinden sich Epochen in Webers Leben. Die drei grosen Opern wurden in den knapp zehn Jahren geschrieben, die der Komponist als Kapellmeister am sachsischen Hof gewirkt hat. Aber keine der Opern ist dort uraufgefuhrt worden. Der »Freischutz« in Berlin, die »Euryanthe« in Wien, der »Oberon« in London — darin spiegelt sich mehr als die ihm verweigerte Gelegenheit, als Prophet im Vaterlande zu wirken. In dieser Konstellation der Auftrage wird die von Grund auf besondere Stellung Webers in der musikalischen Welt der Romantik sichtbar: der zufallig in Eutin geborene, dann wahrend des unsteten Wanderlebens mit dem Vater durch alle elf Kreise des untergehenden Romischen Reichs deutscher Nation umhergeworfene Musiker war in Traditionen, nicht in Landschaften verwurzelt. An diesen Traditionen, mit denen er in fruhesten Jahren und wiederum eher beilaufi g vertraut wurde, hielt er mit erstaunlicher Konsequenz und mit fruhem Sendungsbewustsein fest.
Archive | 2007
Carl Dahlhaus; Norbert Miller
Mit seiner Ruckkehr aus Leipzig (am 26. September 1814) und seiner Wiedereinstellung in den Justizdienst scheint in Hoffmanns Leben die Laufbahn des Musikers — des Komponisten, des Dirigenten, und weithin auch des Kritikers — so abrupt abgeschlossen, das die Forschung aus dem unbestreitbaren Tatbestand, das an Stelle der musikalischen jetzt ausschlieslich erzahlerische Werke getreten sind und das mit dem Ortswechsel sich gewissermasen auch ein Berufswechsel vollzogen hat, den Schlus gezogen hat, der Komponist habe spatestens 1816 aus Einsicht in seine eigentliche Begabung seinem Traum von der Musik freiwillig Valet gesagt. »Wie ein Besessener«, heist es in der Einleitung zu Paul Greeffs 1948 erschienener Monographie, »suchte er in der Musik nach dem entsprechenden Ausdruck, suchte er in ihr die Sprache des neuen Weltgefuhls, das ihn erfullte. Das er es nicht fand, war schlieslich wohl der tiefere Grund dafur, das er die Feder vor dem entscheidenden Schritt absetzte und als Dichter das Gebiet als unbestrittener Herrscher betrat, das in der Musik der Grosere, Weber, nunmehr auf den Gipfel fuhren sollte. Es darf dabei freilich niemals auser Acht gelassen werden, das Hoffmann es war, der in seinem letzten dramatischen Werk, der ›Undine‹, Weber den Weg zu der neuen, romantischen deutschen Oper gewiesen und geebnet hat.«1 In der Tat weis Gerd Allroggens Werkverzeichnis nach dem Abschlus der in Dresden und Leipzig 1813/14 fertiggestellten »Undine« nur mehr zwolf (von insgesamt 85) Kompositionen anzugeben, mit zwei Ausnahmen kleine und kleinste Gelegenheitsarbeiten: ein halbes Dutzend Lieder und Chore fur die Jungere Liedertafel, eine veranderte Introduktion zur »Undine« fur die Buhnenfassung und ein paar Stammbuchblatter, darunter der schone »Nachtgesang« aus Maler Mullers »Genovefa«, den der Komponist am 14. November 1819 in Louis Spohrs Stammbuch eintrug.
Archive | 2007
Carl Dahlhaus; Norbert Miller
In frostiger Anlehnung an das klassizistische Drama hatte die franzosische Oper uber das Ende des 18. Jahrhunderts hinaus an Glucks Forderung festgehalten, Musik und Libretto der ernsten Oper seien in jedem Augenblick auf den dramatischen Konfl ikt zu beziehen. Die Revolutionsoper hatte zwar fur mehr als ein Jahrzehnt die am Singspiel orientierte Mischform der »Rettungsoper« etabliert — mit ihrem dramaturgischen Wechsel von gesprochenem Dialog, Melodram und musikalischer Einzelnummer, mit ihrer popularen Stoffvielfalt des Effektvollen und Ruhrenden —, aber nicht nur blieb in den herausragenden Romer-Opern, in denen sich das politische Sendungsbewustsein der Revolution, des directoire und des spateren Kaisertums mit Vorliebe spiegelte, das Pathos der Einfachheit ungebrochen, sondern auch die aufwuhlenden, alle Leidenschaften beschworenden Schopfungen des neueren Operntypus folgen dramaturgisch der gleichen Unterordnung aller Elemente unter das Gebot der Buhnenfunktion und bleiben musikalisch wie selbstverstandlich in der uberlieferten Ordnung der musikalischen Affekte. Die in sich richtige Bemerkung, die eigentlichen Neuerungen der Revolutionsoper gingen mehr auf die Rechnung der Librettisten und Buhnenbildner als der im Konventionellen beharrenden Komponisten, trifft die Situation und Leistung der franzosischen Oper nach 1790 nur unzureichend: Wie der Schatten Voltaires uber dem gleichzeitigen franzosischen Drama liegt der Schatten Glucks, aller programmatischen Rangverschiebungen in der Oper ungeachtet, uber dem musikdramatischen Denken der Jahrhundertwende.
Archive | 2007
Carl Dahlhaus; Norbert Miller
Im September 1847 beendete Franz Liszt mit einem Konzert im russischen Elisabethgrad seine Laufbahn als Klaviervirtuose und zog sich (Anfang 1848) fur mehr als ein Jahrzehnt in die provinzielle Abgeschiedenheit von Weimar zuruck, das seit Goethes Tod seine europaische Anziehungskraft fast ganz verloren hatte und wieder zur Residenz eines der vielen deutschen Duodezfurstentumer geworden war: eine Residenzstadt mit Erinnerungen. Zunachst war es Liszt bei seiner Ubersiedlung wohl nur um ein vorubergehendes Refugium zu tun: hier in Weimar, wo der mit ihm befreundete Grosherzog Carl Alexander ihn durch ein Dekret vom 2. November 1842 zum »Kapellmeister im auserordentlichen Dienste« ernannt hatte, konnte er in Muse das Ergebnis der Ehescheidungsklage der Furstin zu Sayn-Wittgenstein abwarten und in der Zwischenzeit von dem als Verpfl ich-tung umschriebenen Angebot Gebrauch machen, »bei seiner Anwesenheit hier die Kapelle zu seinen Leistungen aufzufordern und zu benutzen«.1 Noch am 8. Juli 1859 gibt er sich in einem Brief an Raff ganz unentschlossen, ob er den kunftigen Winter in Weimar zubringen werde.2 Dennoch kommt Liszts Entschlus, nach dem Bruch mit der eigenen, beispiellosen Karriere und der Hinwendung zur unsicheren Existenz eines im Metier noch weithin unerfahrenen Komponisten nun auch noch die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts mit der Provinz zu vertauschen, von Anfang an der Charakter eines programmatischen Anspruchs an sich selber zu: die Wiederbesinnung auf seine Sendung als schaffender Kunstler, an der er zwar — von den ungelenken Versuchen des Wunderkindes bis zu den kuhnen Exzentrizitaten seiner beiden Etuden-Sammlungen — im ganzen unbeirrt festgehalten hatte, die aber in den eher bagatellmasigen Gelegenheitsarbeiten seiner letzten sieben Virtuosenjahre halb verschuttet war, diese Wiederbesinnung zwang Liszt auch zu einer Uberprufung des zu Anfang eingeschlagenen Weges und damit zu einer kritischen Distanz von seiner Pariser Vergangenheit, auch wenn das partiell die Preisgabe von wichtigen Konnexionen, den Verzicht auf das kulturelle Leben in den Salons und die Trennung von der kunstlerischen Avantgarde bedeutete.3
Archive | 2007
Carl Dahlhaus; Norbert Miller
Im Herbst 1822 besuchte Gioacchino Rossini, der eben mit seinem dramma per musica an der Wiener Oper einen nicht dagewesenen Triumph gefeiert hatte, den von ihm lange bewunderten Beethoven. Bei diesem einzigen Treffen der beiden einfl usreichsten Komponisten ihrer Zeit gab Beethoven dem italienischen Maestro den spater oft ihm nachgesprochenen Rat: »Ihr seid der Autor des ›Barbier von Sevilla‹! Ich begluckwunsche Euch, das ist eine ganz ausgezeichnete Oper, die ich mit grosem Vergnugen studiert habe […]. Versucht aber nie, etwas anderes als komische Oper zu schreiben: den Erfolg in einem anderen Genre suchen, hiese, Eurer Natur Gewalt antun.« Rossini selbst hat 1860 die Begegnung in seinem Gesprach mit Richard Wagner aus spater, wenn schon lebhafter Erinnerung geschildert.1 Er erzahlt von ihr ohne Ironie, ohne Ressentiment, obwohl das zweifelhafte Kompliment ihn damals irritiert haben muste. Schlieslich war er seit zehn Jahren in der europaischen Opernwelt vor allem als der Komponist groser, tragischer Werke gefeiert, als der Autor des »Tancredi«, der »Elisabetta, Regina d’Inghliterra«, des »Otello«, »Mose in Egitto« und der »Donna del Lago«. Auch die »Zelmira«, mit der sich Rossini am 16. Februar 1822 im Teatro S. Carlo siegreich von seinem neapolitanischen Publikum verabschiedet hatte, war ja eine opera seria, wie Beethoven sehr wohl wuste. Die Wiener Kritik war ausnahmsweise mit der italienischen einer Meinung: die Komposition sei das Werk eines Meisters, des armlichen Librettos ungeachtet, und Rossini habe sich mit diesem Drama uber die anderen italienischen Opern, auch uber den grosten Teil seiner eigenen, machtig erhoben, vielleicht weil er sich beim Schreiben bereits die deutschen Verhaltnisse vor Augen gehalten habe, wie der Korrespondent der Leipziger »Allgemeinen Musikalischen Zeitung« befand.2
Archive | 2007
Carl Dahlhaus; Norbert Miller
Die romantische Oper — die Oper aus dem Geiste der Romantik — war in ihrer gesamten Geschichte, von E.T.A. Hoffmann bis zu Hans Pfi tzner, mit Schwierigkeiten belastet, die sich immer wieder als eigentlich unlosbar erwiesen, gerade dadurch aber zu treibenden Motiven einer Entwicklung wurden, die nicht allein im musikalischen Drama, sondern daruber hinaus in der Instrumentalmusik zu weitreichenden, zwischen Romantik und Moderne vermittelnden Konsequenzen fuhrte.